Das Abstraktionsprinzip, dass der Regelung des BGB zugrunde liegt, stammt aus dem römischen Recht und hat sich vorallem im vorherigen Jahrhundert unter dem Einfluss von Savigny durchgesetzt.
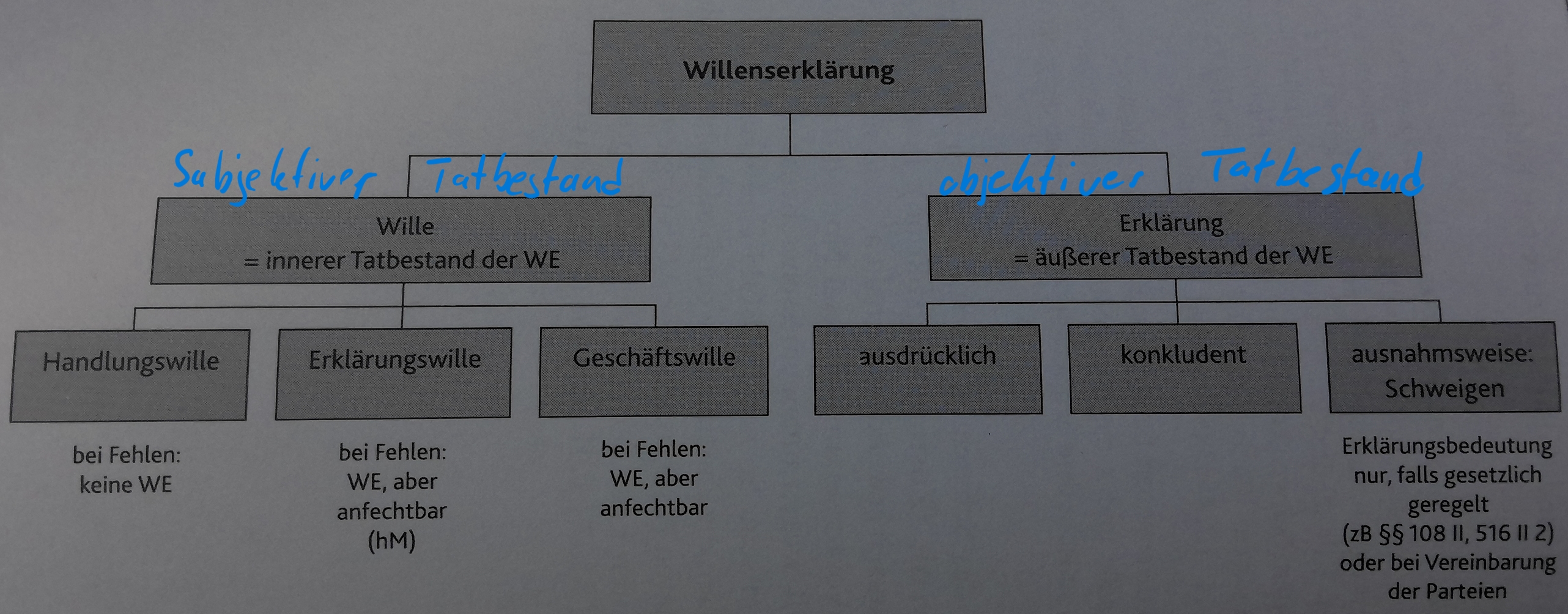
- Empfangsbedürftige WE sind solche, die an eine andere Person (Erklärungsempfänger) gerichtet sind.
Für ihre Wirksamkeit ist es unerlässlich, dass die WE beim Erklärungsempfänger zugeht und dieser diese auch wahrnehmen kann. - Nicht empfangsbedürftige WE sind solche, die nicht an eine andere Person gerichtet sind.
- Realakte sind solche Handlungen, an welche die Rechtsordnung unabhängig von einem entsprechenden Willen des
Handelnden Rechtsfolgen knüpft.
Bsp.: A malt ein Bild auf eine dem B gehörende Leinwand, dadurch wird A unanhängig davon, dass er das Will oder nicht, Eigentümer der neuen Sache (§950 BGB). Auch wenn A z.b. durch eine geistige Störung gar nicht willensfähig ist (vgl. §§104 Nr.2, 105 II BGB), erlangt er durch das Gesetz (§905 BGB) das Eigentum an der neuen Sache. - Geschäftsähnliche Handlungen sind Willensäußerungen oder Mitteilungen, an die das Gesetz Rechtsfolgen knüpft, ohne dass diese vom Äußernden gewollt sein müssen. Bsp.: S schuldet G eine Leistung, um den S dazu zu bewegen diese Leistung zu leisten und somit seine Schulden zu tilgen, mahnt G den S. Nach §286 BGB knüpft dass Gesetz an die Mahnung den Schuldenverzug, der den G berechtigt von S Schadensersatz zu verlangen, welcher ihm durch den Verzug entstanden ist (§§280 I, II, 86 I BGB). Ob G durch die Mahnung auch die Verzugsfolgen herbeiführen oder lediglich den S zur Zahlung bewegen wollte, ist irrelevant.
Bei der Abgabe einer WE muss zwischen einer mepfangsbedürftigen WE und einer nicht empfangsbedürftigen WE unterschieden werden:
- Die Abgabe einer
liegt dann vor, wenn der Erklärende sich der WE entäußert; diese werden unter regelmäßigen Umständen bereits mit der Abgabe wirksam
- Die Abgabe einer
liegt dann vor, wenn der Erklärende sich der WE entäußert und diese so Richtung Erklärungsempfänger, schickt, dass unter regelmäßigen Umständen mit dem Zugang bei diesem gerechnet werden darf; des weiteren wird unterschieden in mündliche und schriftliche WE unter Abwesenden und Anwesenden:
- Eine mündliche WE gegenüber einem Anwesenden gilt als abgegeben, wenn sich der Erklärende so der WE entäußert hat, dass der Erklärungsempfänger in der Lage ist diese zu verstehen (dies gilt auch für telefonische Erklärungen)
- Eine mündliche WE gegenüber einem Abwesenden kann mittels eines Boten abgeben werden. Der Erklärende hat dann alles für das Wirksamwerden der WE getan, wenn er die Erklärung dem Boten vollständig mitgeteilt hat und diesem die Weisung gegeben hat die WE zu überbringen.
- Eine schriftliche WE gegenüber einem Anwesendengilt als abgegeben, wenn diese dem Erklärungsempfänger zur Entgegennahme überreicht wird.
- Eine schriftliche WE gegenüber einem Abwesenden gilt als abgegeben, wenn der Erklärende das vollendete
Schriftstück so Richtung Erklärungsempfänger geschickt hat, dass unter regelmäßigen Umständen mit dem Zugang
gerechnet werden darf
- Abhanden gekommene WE
Gibt der Erklärende die WE nicht selber ab (zb. weil er noch einmal darüber nachdenken möchte) sondern einer andere Person ohne die erforderliche Befugniss (zb. Haushaltshilfe, Frau, etc.) so liegt, nach dem historischen Gesetzgeber, keine gültige WE vor, da diese ohne denn Willen des Erklärenden in Richtung des Erklärungsempfänger gesendet wurde
nach h.M. ist die gültigkeit jedoch zu bejahen, wenn der Erklärende das Inverkehrbringen der WE durch unsorgfältige Aufbewahrung veranlasst hat; demnach kann er sich nur noch durch eine Anfechtung von der WE lösen, das hat auch zur Folge, dass der Erklärende dem Erklärungsempfänger ggf. Schadensersatz schuldig ist, da dieser auf die Gültigkeit jener WE vertraut hat vgl. §122 I BGB - Elektronische WE
Bei einem Telefax-System, einem E-Mail-System oder einem sonstigen Vergleichbaren System, bei dem keine direkte Kommunikation möglich ist (Telefon, Chat, etc.) gilt eine WE als abgeben, wenn die Versendung der WE durch Mausklick, betätigen der Return/ Enter Taste oder die Veranlassung einer Fernkopie (Fax) veranlasst wird
- Abhanden gekommene WE
-
-
Zugang herrscht nach h.M. dann, wenn die WE so in den Machtbereich des Erklärungsempfänger gelangt ist, dass dieser die Erklärung zur Kenntniss nehmen kann und unter normalen Umständen mit der Kenntnisnahme zu rechenen ist
- Machtbereich
- räumlicher Machtbereich
Der räumliche Machtbereich (MB) umfasst den Hausbriefkasten, die Wohnung Geschäftsräume; ob der Adressat sich aktuell auch an der heimischen Postanschrift befindet ist unerheblich
--Coming Soon-- - sonstige Machtbereiche
Neben dem räumlichen MB kommt jeder andere Bereich in frage, darauf ist insbesondere bei technishen Kommunikationsmittel abzustellen; hier beteht der Zugang erst wenn die WE von dem designierten Empfangsgerät vollständig aufgenommen wurde
- Beim Fax gilt eine WE als zugegangen, wenn das Empfangsgerät die Informationen vollständig empfangen und gespeichert hat (früher hat der BGH auf das Ausdrucken einer harten Kopie abgestellt)
- Eine WE per E-Mail gilt als zugegangen, wenn sie in der Mail-Inbox des Empfängers angekommen ist
- Bei WE in Kunden-Online-Portalen (von Firmen bereitgestellt) ist der Zugang nur zu bejahen, wenn der Kunde über ein eigenes Passwortgeschützen Profil mit eigenem Speicherplatz verfügt und dem Unternehmen ein nachträglichen Ändern von Informationen nicht mehr möglich ist
- räumlicher Machtbereich
- Möglichekit der Kenntnisnahme
Dem Erklärungsempfänger muss es weiterhin möglich sein, von der WE Kenntniss zu nehmen - Zeitpunkt einer möglichen Kenntnisnahme
- Briefkasten
- ausschlaggebend ist die Zeit, mit der die Leerung des Briefkastens erwartet wird; im Normalfall ist dies (bei Privaten Personen) spätestens der Morgen/ Vormittag des nächsten Werktages (aus Samstag), bei (geschäften) ist es der nächste Geschäftatag
- zusätzlich, kann von einer Nachschau im laufe des Tages ausgegegangen → Briefe die am Vormittag eingeworfen wurden, werden ggf. noch am selben Tag zur Kenntniss genommen, am Nachmittag/ Abend eingeworfene Breife üblicherweise erst am nächsten Werktag
- Wichtig ist für eine fristgerechte Abgabe ist das Datum des Zugangs der WE, die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist allerdings abstrakt zu bewerten, da eine WE auch dann als zugegangen gilt wenn der Erklärungsempfänger (Krankheits- oder Urlaubsbedingt) eine Annahme der Erklärung nicht durchführen kann, in solchen Fälle muss sich der Erklärungsempfänger um nötige Vorkerhungen bemühen
- Online
- E-Mail
- privat
ähnlich zum Briefkasten, kann damit gerechnet werden, dass die Email-Inbox einmal
täglich gecheckt wird, eine vermutliche einheitliche Zeit wie beim Briefkasten,
lässt sich jedoch nicht bestimmen
→ Zugang spätestens ein Tag nach Eingang - geschäftlich
Zugang nach den Gepflogenheiten des Geschäftsbetriebes, spätestens jedoch am Ende
eines Geschäftstages (bei 24h Services rund um die Uhr)
→ Danach erst wieder am nächsten Geschäftstag (meistens exklusive Wochenende)
- privat
ähnlich zum Briefkasten, kann damit gerechnet werden, dass die Email-Inbox einmal
täglich gecheckt wird, eine vermutliche einheitliche Zeit wie beim Briefkasten,
lässt sich jedoch nicht bestimmen
- Online-Postfächer
Hat ein Unternehmen ein Online-Postfach für seine Kunden auf ihrer Webseite eingerichtet, so ist der Zugang schwer zu bestimmen, da im Normalfall der Kunde nicht ohne besonderen Grund täglich dieses Postfach kontrolliert; versendet das Unternehmen mit jeder nachticht über das Portal jedoch auch noch einen Benachrichtungsmail an die private Adresse, gilt die Nachricht im Online-Postfach mit dem Zugang der Benachrichtungsmail als zugegangen
- E-Mail
- Briefkasten
- Machtbereich
- Mittelspersonen
- Empfangsvertreter
sind Personen, die dazu berechtigt sind, Briefe zu öffnen, zu lesen und zu bearbeiten; geht eine WE dem Empfangsvertreter zu, so gilt sie auch dem Vertretenden als zugegangen - Empfangsbote
Ist die Mittelsperson kein Vertreter so kann sie ein Empfangsbote sein, Empfangsboten sind dazu ermächtigt WE anzunehmen und weiterzuleiten; eine an einen Empfangsboten abegegebene WE gilt als dann zugegangen, wenn unter regelmäßigen Umständen mit der Weiterleitung gerechnet werden kann - Erklärungsbote
Ist die Mittelsperson auch kein Empfangsbote, so ist sie ein Erklärungsbote; hier trägt der Erklärende das Risiko der Fristeinhaltung, sowie der korrektenn Zustellung, zugegangen gilt eine WE über einen Erklärungsboten dann, wenn die WE an den Erklärungsempfänger selbst zugestellt wird
- Empfangsvertreter
-
-
Gesetzlich nicht geregelt, der Grundgedanke aus §130 BGB muss angewendet werden und es muss unterschieden werden:
- Eine schriftliche Erklärung ist wirksam, sobald sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt, unter regelmäßigen Umständen ist dies mit der Übergabe der Fall
- Um zu bestimmen, wann eine mündliche Erklärung als zugegangen gilt gibt es zwei Theorien:
Reine Vernehmungstheorie
Der Zugang einer mündlichen WE unter anwesenden liegt dann vor, wenn der Erklärungsempfänger die WE akustisch vernommen hat
Problem: Der Erklärungsempfänger, hat die WE nicht wahrgenommen (zb. weil er nicht zugehört hat, taub ist oder die Sprache nicht versteht) ist die WE nach der reinen Vernehmungstheorie nicht zugegangen; Dies ist zu ungunsten des Erklärenden ist nicht interessengerecht und unvereinabr mit dem Gedanken asu §310 I 1Eingeschränkte Vernehmungstheorie
Der Zugang einer mündlichen WE unter Anwesenden ist dann zugegangen, wenn der Erklärende vernünftiger Weise keine Zweifel daran haben kann , dass der Erklärungsempfänger die WE akustisch und vollständig verständen hat (bestehen Zweifel, muss sich der Erklärende vergewissern, dass der Erklärungsempfänger die WE akustisch und vollständig verstanden hat, andernfalls ist die WE nicht zugegangen und so unwirksam)
-
- Verweigerung der Annahme:
- berechtigte Verweigerung
in gewissen Situationen darf der Erklärungsempfänger die Annahme der We verweigern (zb. wenn er Porto nachzahlen soll, wegen unzureichender Frankeierung), in diesen Fällen geht dies zulasten des Erklärenden - unberechtigte Verweigerung
wenn der Erklärungsempfänger sich durch eine grundlose/ unberechtigte Verweigerung der WE "entzieht" (zb. weil er mit einer Kündigung rechnet aber nicht möchte das dies eintritt), so wird der Zugang so fingiert, dass die WE als in dem Moment zugegangen gilt, in dem sie ohne die Annahmeverweigerung zugegangen wäre
- berechtigte Verweigerung
- fehlende/ fehlerhafte Empfangseinrichtung:
Wird der Zugang einer WE durch fehlende/ fehlerhafte Empfangseinrichtungen (fehlender Briefkasten, Namensschild, ausgesschaltetes Faxgerät, überfüllte E-Mail-Box) so geht dies zulasten des Erklärungsempfänger, wenn dieser mit einer rechtsgeschäfltichen Erklärung rechnen musste; Ob der Empfänger dabei Schuld hat, ist irrelevant, es genügt wenn die Verhinderung/ Verzögerung in seiner Sphäre liegt
Früher wurde die WE als wirksam angesehen, als wäre sie ohne Verhinderung/ Verzögerung zugegangen; heute lässt man dem erklärenden die Wahl:- Er kümmert sich nicht mehr rum
→ Rechtsfolge der WE treten nicht ein ("verkümmern") - Er kümmert sich um weitere Zustellungsversuche
→ Rechtsfolgen der WE treten ein und eine ggf. verspätete WE ist zu behandeln als wäre sie rechtzeitig zugegangen
- Er kümmert sich nicht mehr rum
- Verweigerung der Annahme:
-
- Abgabe einer We gegenüber einem nicht voll Geschäftsfähigen:
- Geschäftsunfähiger:
Eine WE gegenüber einem Geschäftsunfähigen (§104 BGB) wird wirksam, wenn sie dem entsprechenden gesetzlichen Vertreter zugeht; dabei ist maßgeblich, dass die WE dem Vertreter nicht nur zufällig bekannt wird, vielmehr muss die an ihn gerichtet sein oder zumindest für ihn bestimmt sein - Beschränkt Geschäftsfähiger:
Für beschränkt Geschäftsfähige gilt die selbe Regelung
Ausnahme: Ist die We für den beschränkt Geschäftsfähigen, rechtlich nur Vorteilhaft oder hat der gesetzliche Vertreter bereits eingewilligt, so ist die WE direkt wirksam - Bewusstlos/ vorübergehend Geistetsgesörter:
Ist an sich in §131 BGB nicht geregelt, abgegebene WE in diesem Zustand sind jedoch nach §105 BGB nichtig;
Bei WE gegenüber Abwesenden gelten die Vorschriften aus §130 BGB, WE gegenüber Anwesenden richten sich nach derDer Zugang einer mündlichen WE unter Anwesenden ist dann zugegangen, wenn der Erklärende vernünftiger Weise keine Zweifel daran haben kann , dass der Erklärungsempfänger die WE akustisch und vollständig verständen hat (bestehen Zweifel, muss sich der Erklärende vergewissern, dass der Erklärungsempfänger die WE akustisch und vollständig verstanden hat, andernfalls ist die WE nicht zugegangen und so unwirksam)
- Geschäftsunfähiger:
- Behörden:
Gemäß §130 III werden WE die einer Behörde gegenüber abgegeben werden müssen, WE gegenüber Abwesenden gleichgesetzt, dementsprechend finden die Vorschriften aus §130 I, II BGB Anwendung - Ersatzmittel für das Zugehen:
WE können ersatzweise auch durch einen Gerichtsvollzieher (§132 I) oder durch eine öffentlich durch das Amtsgericht (§132 II) zugestelltwerden - Entbehrlichkeit einer Annahme:
Nach §151 BGB darf auf eine Annahmeerklärung verzichtet werden, wenn die Verkehrssitte dies nicht unbedingt vorschreibt oder der Antragende darauf verzichtet
§152 BGB regelt zusätzlich die Annahme bei notarieller Beurkundung
§156 BGB regelt zusätzlich den Vertragsschluss bei Versteigerungen
- Abgabe einer We gegenüber einem nicht voll Geschäftsfähigen: